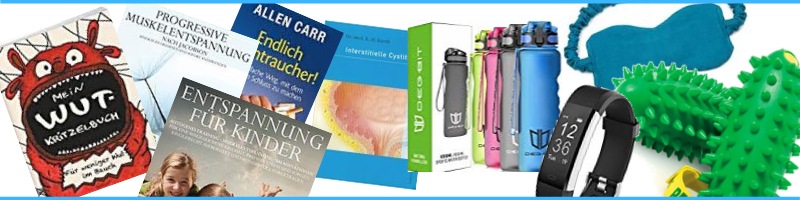Das GesundheitsPortal für innovative Arzneimittel, neue Therapien und neue Heilungschancen
Metastasierter Darmkrebs – Beeinträchtigt eine Aflibercept-Therapie die Lebensqualität?
Original Titel:
Aflibercept Plus FOLFIRI in the Real-life Setting: Safety and Quality of Life Data From the Italian Patient Cohort of the Aflibercept Safety and Quality-of-Life Program Study
DGP – Wenn der Darmkrebs bereits weit fortgeschritten und eine Chemotherapie bereits fehlgeschlagen ist, gibt es für die Patienten die Möglichkeit, sich mit Aflibercept in Kombination mit einer weiteren Chemotherapie behandeln zu lassen. Diese Behandlungsmethode bringt jedoch einige Nebenwirkungen mit sich, wie die vorliegende Studie zeigte. In den meisten Fällen waren diese jedoch gut hinnehmbar oder behandelbar, so dass die Lebensqualität der Patienten während der Behandlung nicht beeinträchtigt wurde.
Darmkrebs, der sich bereits in andere Körperregionen ausgebreitet hat (Metastasen gebildet hat), wird ganzkörperlich behandelt. Dabei kommt in der Regel eine Chemotherapie zum Einsatz. Um den Behandlungserfolg zu erhöhen, kann die Chemotherapie mit weiteren Wirkstoffen einer anderen Wirkstoffgruppe ergänzt werden. Eine moderne Wirkstoffgruppe, die ebenfalls bei einigen Krebserkrankungen zum Einsatz kommt, bilden die VEGF-Hemmer. Diese unterdrücken die Bildung von Blutgefäßen, die für den Tumor wichtig sind, um mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt zu werden. Zu dieser Wirkstoffgruppe gehört unter anderem Aflibercept. Es konnte bereits gezeigt werden, dass die Kombination aus einer Chemotherapie (mit Irinotecan, 5-Fluorouracil und Folinsäure (FOLFIRI)) und Aflibercept das Überleben von Darmkrebs-Patienten mit Metastasen stärker verbessern konnte als die Chemotherapie alleine, nachdem die Chemotherapie mit einem anderen Zytostatikum (Oxaliplatin) gescheitert war. Es wurde jedoch noch nicht betrachtet, wie sich die Kombinationstherapie auf die Lebensqualität der Patienten auswirkt. Da eine Kombination mehrere Wirkstoffe meist auch mehr Nebenwirkungen mit sich bringt, könnte es sein, dass sich die Lebensqualität der Patienten während der Behandlung verschlechtert.
Patienten, bei denen bereits eine Chemotherapie gescheitert ist, wurden mit Aflibercept in Kombination mit einer weiteren Chemotherapie behandelt
Wissenschaftler aus Italien holten dies nun in einer weiteren Studie nach. Sie untersuchten die Sicherheit und den Einfluss auf die Lebensqualität der Aflibercept-Therapie in Kombination mit der Chemotherapie FOLFIRI unter Alltagsbedingungen. Zu diesem Zweck werteten sie Daten von 200 italienischen Patienten mit metastasiertem Darmkrebs aus, die zuvor erfolglos mit Oxaliplatin (alleine oder in Kombination mit dem Wirkstoff Bevacizumab) behandelt wurden. Die Hälfte der Patienten war älter als 63 Jahre und bekam mehr als 7 Aflibercept/FOLFIRI Behandlungszyklen.
Die Therapie war nicht frei von Nebenwirkungen
Fast alle Patienten (97,5 %) waren von Nebenwirkungen betroffen, die auf die Therapie zurückgeführt werden konnten. Die häufigsten schwerwiegenden Nebenwirkungen, die bei mindestens 5 % der Patienten auftraten, waren Bluthochdruck (28,5 %), eine Verminderung der Neutrophile (spezialisierte Immunzellen) im Blut (27,5 %), Schwäche (20 %), Durchfall (17,0 %) und Entzündung der Mundschleimhaut (13,0 %). Ein Patient verstarb während der Studie aufgrund einer Blutvergiftung.
Die Lebensqualität der Patienten änderte sich während der Behandlung nicht
Was die Lebensqualität angeht, welche durch verschiedene, spezielle Fragebögen vor, während und am Ende der Behandlung erfasst wurde, so verschlechterte sich diese während der kombinierten Behandlung mit Aflibercept und FOLFIRI nicht.
Patienten mit metastasiertem Darmkrebs, die zusätzlich zu der Chemotherapie mit FOLFIRI Aflibercept bekamen, nachdem die erste Chemotherapie mit Oxaliplatin gescheitert war, litten häufig unter Nebenwirkungen. In den meisten Fällen waren diese jedoch gut hinnehmbar oder behandelbar, sodass die Sicherheit der Behandlung für gut befunden wurde. Es konnten keine Nebenwirkungen festgestellt werden, die nicht bereits bekannt waren. Interessant war, dass die Lebensqualität durch die Behandlung nicht beeinträchtigt wurde. Somit schien die Kombination aus Aflibercept und der Chemotherapie FOLFIRI für Darmkrebs-Patienten mit Metastasen, bei denen eine vorangegangene Chemotherapie erfolglos war, geeignet zu sein.
© Alle Rechte: DeutschesGesundheitsPortal / HealthCom