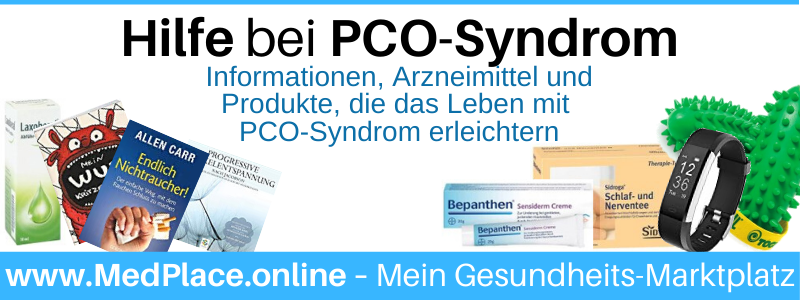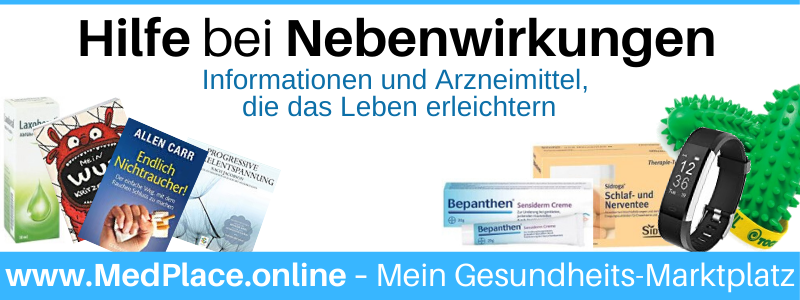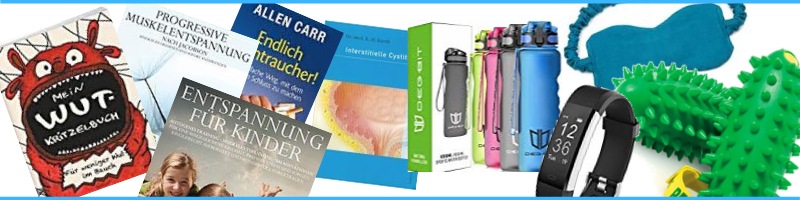Übersicht der Behandlungsmöglichkeiten
Aktuelle Studien- und Forschungsergebnisse
Die Studie zeigt, dass Frauen mit PCO-Syndrom häufig auch an Depressionen und Angststörungen leiden. Dabei begünstigen manche Symptome die Entstehung einer der beiden Erkrankungen stärker. Die psychischen Erkrankungen beeinflussen auch die Lebensqualität.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Stress könnte demnach eine wichtige Rolle beim PCO-Syndrom spielen. Patientinnen berichten über mehr Stress und haben häufiger Depressionen und Angststörungen. Stress könnte ein wichtiger Faktor der Entstehung der psychischen Erkrankungen sein. Stressmanagement könnte daher eine wichtige Rolle für Betroffene spielen.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Hier finden Sie aktuelles aus Forschung und Wissenschaft zu folgenden Themen:
Die Studie deutet an, dass übergewichtige Frauen mit PCO-Syndrom von einer Schlauchmagen-Operation profitieren können. Es zeigten sich sogar leicht bessere Ergebnisse als bei Frauen ohne PCO-Syndrom. Auch konnten einige der Frauen nach der Operation schwanger werden – die meisten von ihnen waren zuvor noch nie schwanger gewesen.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Die Leitlinie umfasst Hinweise zur Diagnose und zur Behandlung des PCO-Syndroms. Obwohl einige Empfehlungen ausgesprochen werden, betonen die Wissenschaftler, dass die Qualität der erhaltenen Daten eher mittelmäßig ist und das Krankheitsbild weitaus mehr Forschung benötigt.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Die im Folgenden beschriebene Auswertung von 23 Studien mit übergewichtigen/adipösen PCO-Patientinnen zeigte, dass durch das Medikament Liraglutid die größte Gewichtsabnahme bei den Patientinnen erzielt werden konnte, gefolgt von Orlistat und Metformin.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Die Studie zeigte, dass untergewichtige und fettleibige Frauen mit PCO-Syndrom ein erhöhtes Risiko für Bluthochdruck während der Schwangerschaft hatten. Bei normalgewichtigen und übergewichtigen Frauen war das Risiko nicht erhöht.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Eine Studie aus Kanada untersuchte jetzt die Ergebnisse mehrerer Studien zum Einfluss von Sport und Bewegung auf das Herz-Kreislauf-System und die Fruchtbarkeit beim PCO-Syndrom. Der Einfluss von Sportübungen auf die Fruchtbarkeit blieb eher unklar, der Effekt auf Gewicht und Herz-Kreislauf-System war aber positiv.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Die Leitlinie umfasst Hinweise zur Diagnose und zur Behandlung des PCO-Syndroms. Obwohl einige Empfehlungen ausgesprochen werden, betonen die Wissenschaftler, dass die Qualität der erhaltenen Daten eher mittelmäßig ist und das Krankheitsbild weitaus mehr Forschung benötigt.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Die Studie zeigte einen Effekt der Laserakupunktur auf Hormone und Insulinresistenz. Begleitet wurde die Laserakupunkturtherapie durch Ernährung- und Bewegungstipps. Für aussagekräftigere Ergebnisse müssen allerdings Studien mit mehr Teilnehmerinnen durchgeführt werden.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Die ovarielle Stimulation ist ein wichtiger Teil der künstlichen Befruchtung, bei der die Reifung der Eizellen und der Eisprung angeregt werden. Wissenschaftler aus China untersuchten jetzt zwei verschiedene Verfahren zur ovariellen Stimulation bei unfruchtbaren Frauen mit PCO-Syndrom.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Inositol ist eine natürliche Substanz, die sowohl Hormone des Stoffwechsels wie Insulin auch als Sexualhormone beeinflussen kann. Beim Polyzystischen Ovarialsyndrom werden die Konzentrationen der Sexualhormone wie Testosteron, Östradiol, Progesteron, Follikelstimulierendes Hormon (FSH) und Luteinisierendes Hormon (LH) aber auch das Stoffwechselhormon Insulin negativ beeinflusst.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Die Studie zeigte, dass der Monat oder die Jahreszeit keinen Einfluss auf klinische, also im Ultraschall nachweisbare Schwangerschaft hatte. Dabei wurden sowohl Transfer mit frischen als auch aufgetauten Embryonen untersucht.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Die Studie untersuchte Metformin, Glitazone, orale Verhütungsmittel und Statine beim PCO-Syndrom. Die Autoren heben besonders hervor, dass Metformin das Gewicht und orale Verhütungsmittel das männliche Erscheinungsbild verbessern können. Sie betonen auch, dass es wenig Wissen zur Behandlung von psychologischen Problemen bei Frauen mit PCO-Syndrom gibt.
Weiter zum ausführlichen Bericht →